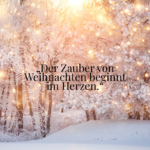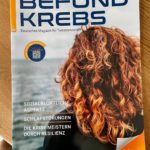Sie teilen einen Teil des genetischen Materials, die Eltern, den Mutterleib, die Kindheit und es ist bei weitem nicht immer leicht, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen. Das Leben von zweieiigen Zwillingen ist ein Tanz zwischen Symbiose und Selbsterhaltung.
Schon immer haben Zwillinge fasziniert. Mythen und Geschichten erzählen von diesen seltsamen Doppelwesen und im Mittelalter glaubte man, die gleichen Geschwister würden sich eine Seele teilen. Je nach Kulturkreis wurden sie entweder als göttlich und segenbringende oder aber als widernatürliche, manchmal sogar mit dem Bösen in Verbindung stehende Wesen angesehen. So oder so, wurde bezweifelt, dass es bei der Zeugung mit rechten Dingen zugehen konnte.
Ist es wahr, dass die Geburt von Zwillingen vererbt wird? Die Antwort ist: Ja – solange es sich nicht um eineiige Zwillinge handelt.
Eineiige Zwillinge haben das gleiche genetische Material, da sie aus derselben befruchteten Eizelle stammen. Sobald das Sperma die Eizelle befruchtet, beginnt sich die daraus entstehende Zelle zu teilen und manchmal teilt sich der Fötus in zwei Teile, wobei jeder von ihnen sich zu einem anderen Baby entwickelt- so werden eineiige Zwillinge geboren.
Zweieiige Zwillinge hingegen werden aus zwei verschiedenen Eizellen und zwei verschiedenen Samenzellen gebildet. Bei dem monatlichen Eisprung einer Frau, reift normalerweise eine Eizelle, welche und aus dem Eierstock in Richtung Gebärmutter wandert, doch manchmal sind es eben gleichzeitig zwei Eizellen. Dabei kann es vorkommen, dass zwei Samen die beiden Eizellen befruchten, und jede befruchtete Eizelle entwickelt sich zu einem Fötus. Auf natürliche Weise geschieht das nur in einem bis vier Prozent der Schwangerschaften – und so werden zweieiige Zwillinge geboren. Sie teilen zwar einen Teil ihres genetischen Materials miteinander, da sie dieselbe Mutter und denselben Vater haben, aber sie sind sich genetisch nicht näher als “normale“ Geschwister.
Wie ist das Leben von Zwillingen?
Die romantische Version lautet ungefähr so: „Zwillinge verbindet ein besonderes Band: Sie wachsen gemeinsam im Mutterleib heran und haben von Geburt an einen Gefährten an ihrer Seite. Diese körperlich, wie emotional enge Beziehung hält oft ein Leben lang. Nicht selten wird das gleichaltrige Geschwisterkind zum besten Freund“.
Teilweise trifft das zu, was jedoch oft völlig außer Acht gelassen wird ist, dass die üblich normalen Maßstäbe der geschwisterlichen Wettbewerb-Situation für Zwillinge nicht gelten.
Der Altersunterschied von Geschwistern fällt bei Zwillingen weg und so finden sich besonders zweieiigen Zwillinge in einer außergewöhnlichen Konkurrenzbedingung wieder. Für Eineiige ist die Welt doppelt, sie wird meistens gemeinsam und harmonisch erlebt. Zweieiige werden von ihrer Umgebung zwar doppelt gesehen, sie selbst definieren sich aber durch ihre persönlichen Unterschiede. Die Ausgangslage für zweieiige Zwillinge ist also, dass ihre Anlagen unterschiedlich sind, die Umwelt und Erziehung aber gerade diese natürlichen Unterschiede zu einem gnadenlosen Instrument der Bewertung der Persönlichkeiten machen.
Wie wirkt sich der “kleine“ Unterschied bei Zwillingen aus? Wie schwierig ist Harmonie der zweieiigen Unterschiede in Familie und Erziehung?
Das, was jeder Mensch sich zuschreibt, nämlich einzigartig und etwas Besonderes zu sein, wird bei Zwillingen, bewusst oder unbewusst infrage gestellt. Vom ersten Lebenstag an und für uns Schwestern seit Beginn des Bewusstseins, wurden wir von unserer Umwelt hauptsächlich nicht als Einzelpersonen betrachtet. Eine einheitliche Bekleidung war zwar nicht die Regel, aber immer ein Hingucker. Allein dieser fehlende Unterschied suggerierte den Betrachtern, dass wir, entgegen unserer genetischen Individualität, eine persönliche Einheit darstellen würden. Und das war der Beginn der Misere.
Da die Größe gleich und das Aussehen anfänglich sehr ähnlich war, war uns meist die Aufmerksamkeit von Mitschülern, Verwandten, Lehrern, Nachbarn und Freunden sicher (wir wurden gerne nebeneinander aufgestellt und zusammen betrachtet).
Es war natürlich keineswegs so, dass wir von Natur aus gleich waren. Über Aussagen wie, „die ist aber etwas die Hübschere“ war meine Schwester mit Recht tief verletzt und verunsichert. Und genauso verunsichert wuchs in mir ein schlechtes Gewissen, dafür wer ich war, heran.
Es gibt nur wenige Studien, die sich mit der Frage beschäftigen, was es bedeutet, stets Teil eines Duos zu sein. Wie es sich anfühlt, immer wieder im Mittelpunkt zu stehen – weil Zwillinge nun einmal etwas Besonderes sind – und somit kaum als einzelne Persönlichkeit wahrgenommen werden. Wie es ist, ständig verglichen, oft auch verwechselt zu werden und sich nicht nur von den Eltern, sondern vom Zwillingsgeschwister lösen zu müssen. Darüber wird kaum berichtet.
Diese Form der ungefragten Aufmerksamkeit führte bei uns dazu, dass nahezu alle Betrachter und auch die eigene Familie immer wieder darauf konzentriert war, trotz der Ähnlichkeiten Unterschiede zwischen uns Beiden zu suchen und zu finden. Die für uns unangenehmen Fragen begann meistens mit: Wer von euch Beiden ist denn nun größer, wer schlauer, sind eure Schulnoten gleich, warum seid ihr nicht gleich angezogen, habt ihr die gleichen Hobbys und Freunde? Und stets lief diese Fragerei darauf hinaus, Qualitäts- und Leistungsunterschiede zwischen uns festzustellen, ohne darauf zu achten, wie wir emotional individuell mit den Antworten (die uns dazu oft in den Mund gelegt wurden) umgehen konnten. Vom ersten Tag unseres Bewusstseins waren wir zu diesem gegenseitigen Konkurrenzdenken verdonnert. In der Kindheit schweißte uns das zwar auch zusammen, ließ uns jedoch permanent untereinander Vergleiche anstellten, was sich auf unseren Umgang miteinander, besonders als Teenager, manchmal negativ ausgewirkte.
Unterschiedliche Leistungen waren für Lehrer und anderen Personen gerne der Grund zu bewerten mit dem Ziel, der „Schlechteren” einen Ansporn zu geben. Daraus entstand die ständige Sorge als Versagerin oder Gewinnerin dem Ansehen nicht gerecht zu werden, oder die Schwester zu kränken. Diese Tatsache kann in einem Zwillingsdasein, ohne die Chance einer natürlich rücksichtsvollen Unterschiedsbetrachtung, wie eben dem Altersunterschied bei Geschwistern, zerstörerisch sein.
In der Schule und der Nachbarschaft hatten wir ebenso überwiegend dieselben Freunde. Auch das führte zwangsläufig zu einem immer wieder auftauchenden “Anerkennungswettlauf”, der dann zwischendurch leider auch mal in der für Kinder schmerzenden Feststellung mündete: “Ich bin die Unbeliebtere”, um im gleichen Moment gefragt zu werden, „wo ist den deine Schwester, habt ihr Streit?“ Absolut verständlich, dass unter diesen Umständen eine frühzeitige und gesunde Entwicklung einer eigenständigen selbstbewussten Persönlichkeit sehr schwer war. Das könnte auch der Grund dafür sein, dass Freundschaften mit anderen meist eher oberflächlich blieben.
Erst die schmerzhafte Trennung durch meinen Job an Bord eines Kreuzfahrtschiffes führte zu einer Wahrnehmung als Einzelpersonen durch eine neue, nicht vom Zwillingsstatus beeinflusste Umwelt. Leider für einem hohen Preis, denn die jugendlichen Verhaltensmuster wirken nach wie vor. Die Kränkungen haben Narben auf der Seele meiner Schwester und eine stetig anhaltende Verunsicherung hinterlassen und trotz meiner “Abnabelung“, fühle ich die Trauer über das Geschehene während unserer unschuldigen kindlichen Zwillingszeit und ein ständiger Gewissenskonflikt bei Erfolgen.
Hat das Zwilling sein auch Vorteile?
Da wir seit Kindertagen wussten, dass unüberlegten Äußerungen schnell zu einer Bloßstellung bzw. einem “schwesterlichen Angriff” führen konnte, waren wir schon früh darauf sensibilisiert, mündlich, und später schriftlich Formulierungen zu finden, die möglichst den Konjunktiv berücksichtigten. Das mag sich jetzt nicht sonderlich positiv anhören, doch es förderte eine starke schwesterliche Solidarität.
Im Leben nach dieser “Zwillings-Schule“ fällt es mit dieser geübten Situationsbetrachtung nicht schwer, Ursache und Wirkung einzuschätzen und zuzuordnen, um daraus meist zutreffende Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir sind beide sehr empathisch und sensibel auch Dritten gegenüber.
Erziehung bei zweieiigen Zwillingen:
Bei nicht gleichgeschlechtlichen Zwillingen tritt diese Problematik vermutlich, dank der natürlicher Unterschiede, nicht so auf. Anhand meiner Erfahrungen und den oben geschilderten und teilweise (für Kinder und Jugendliche) schonungslosen Dual-Situation, sollten vorhandene Ähnlichkeiten in der Beurteilung kein Erziehungsinstrument der Zwillinge sein. Hier kann ich Zwillings-Eltern nur empfehlen, in der Erziehung grundsätzlich mit konkurrierenden und vergleichenden Geschwister-Argumenten sehr vorsichtig zu sein und diesen Hinweis genauso an das Umfeld zu kommunizieren. Es ist ratsam auch auf unterschiedliche Kleidung sowie das allgemeine Äußere zu achten und wenn irgendwie möglich hilft die Gruppen- und Klassen-Trennung in Kindergarten und Schule. Vor allem unterschiedliche Sportarten in verschiedenen Vereinen sind sinnvoll, weil dort die Persönlichkeitsmerkmale ohne einen familiären Konkurrenzdruck erlebt werden kann. Auch getrennte Urlaube bei Verwandten, Freizeiten, Sprachschulen, etc. helfen in der Entwicklung eigenständiger Sozialkontakte.
Und weil Lachen hilft – Zwillinge beim Selfie:
„Lösch das, ich sehe da total scheiße aus.“
„Das bin ich, du Idiotin.“