
Warum sprechen wir nicht über die eigentlich natürlichste Sache der Welt? Vermutlich weil wir Menschen den Tod mit dem Ende verbinden und ihn so als das Gegenteil des Lebens sehen. Dabei ist der Tod die einzige Garantie, die wir mit unserer Geburt bekommen. Alles andere ist das Leben, das völlig offen mit unserer Individualität gestaltet werden will. Und doch erscheint vielen das Lebensende abstrakt und häufig fürchten wir uns vor ihm, weil es keine Antwort auf Fragen, wie „was passiert danach?“ oder „wie fühlt sich das Sterben an?“ gibt. Die Gedanken an das Sterben lösen traurige und damit negative Gefühle in uns aus. Der Tod zeigt uns immer wieder die Vergänglichkeit unseres Lebens und während wir viele Dinge in unserem Leben steuern können, sind wir dem Tod machtlos ausgeliefert. Ob durch eine schwere Krankheit, wie meine Krebserkrankung oder einen unglücklichen Treppensturz, wann und wie er kommt, finden wir erst heraus, wenn er da ist. Diese Ungewissheit über unsere Endlichkeit ruft sicherlich auch bei mir Unbehagen hervor.
Auch wie wir als Kinder mit dem Thema konfrontiert wurden, vielleicht sogar in frühen Jahren schon einen großen Verlust erleben mussten, lässt uns das Thema, verständlicher Weise, lieber vermeiden. Durch die schmerzhafte Vorstellung einen geliebten Menschen zu verlieren, möchten wir uns mit dem Sterben nicht weiter auseinandersetzen. So wird das Thema in der Familie ausgeblendet und ist sicher auch selten ein Thema, welches wir bei einem gemeinsamen Abend mit Freunden besprechen.
Wann sprechen wir heute über den Tod?
Die Diagnose einer schweren Krankheit bei einem nahestehenden Menschen oder ein plötzlicher Verlust, lässt uns oft geschockt und hilflos zurück. Es fällt schwer solche Schicksalsschläge anzunehmen. Wir fühlen uns wie gelähmt, wissen nicht damit umzugehen und empfinden es natürlich oft als ungerecht. Die Frage, „warum ich, er oder sie?“ lässt und anfangs kaum los. Dazu kommt, dass wir in unserer hektischen Zeit, in der immer und überall Multitasking gefordert wird, uns kaum die notwendige Zeit zu trauern nehmen können. Und so verdrängen wir wieder und sind auch als Eltern gerne überfordert, wenn unsere lieben Kleinen anfangen sich Gedanken über das Sterben zu machen und beginnen Fragen zu stellen. Es ist so, als ob der Tod nicht in unserem Lifestyle zu passen scheint, dabei gehört er kompromisslos zum Leben dazu. Können wir lernen mit dem Tod umzugehen?
Meine Oma ist schon vor fünfundzwanzig Jahren mit zweiundachtzig verstorben. Dennoch ist sie immer bei mir, wenn ich ihre Lebensweisheiten brauche und an sie denke. Sie war Krankenschwester und Sterbeamme und pflegte ihren Ehemann, der mit knapp sechzig Jahren an Knochenmarkkrebs erkrankte, bis zu seinem Ende bei ihnen zu Hause. Leider konnten meine Zwillingsschwester und ich unseren Opa nie kennenlernen. Er verstarb nur wenige Tage vor unserer Geburt.
Das mag der Grund sein, warum Oma schon früh mit uns Kindern über die Vergänglichkeit aller Dinge und das dies zum natürlichen Kreislauf des Lebens dazugehört, gesprochen hat.
Oma glaubte auch an Seelenwanderung und begrüßte ihren verstorbenen Ehemann jeden Morgen mit einem gut gelaunten „Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen und guten Morgen“. Dabei tippte sie mit dem Zeigefinger auf jedes, der vier schwarz-weiß Bildchen auf dem Fotostreifen, der über dem Abreißkalender befestigt war. Der Gedanke an Seelenwanderung war mir etwas unheimlich. Die Vorstellung hingegen, dass wir im Himmel lachend auf einer riesigen Schaukel sitzen, gefiel mir da schon besser. Und weil sie so offen und selbstverständlich über den Tod gesprochen hat, verkrafte ich heute meine Krebsdiagnose vermutlich besser als manch anderer.
Viele sagen, dass sie sich nicht direkt vor dem Tod fürchten, aber vor Krankheit, Schmerzen und Leiden. Natürlich möchte das niemand erleben, doch wir können uns unser Schicksal nicht aussuchen und ist der Tod in solchen Fällen nicht erst recht eine Erlösung?
Unsere Oma hat uns das gerne pragmatisch erklärt: „Ich muss euch doch nicht leidtun, wenn ich sterbe. Mir geht es dann gut und Schmerzen habe ich auch nicht mehr. Darüber könnt ihr euch freuen und ich werde immer in euren kleinen Herzen sein.“ Alles ist vergänglich. Ohne diese Tatsache würden wir nicht existieren und weiter erzählte sie: „Als wären wir ein Blatt an einem schönen Baum. Wir tanzen im Wind, spenden Schatten und irgendwann verwelken wir und fallen vom Baum auf die Erde. Dort schützen wir andere kleine Pflänzchen vor Kälte und Schnee, bis wir wenn es wärmer wird Humus werden, welcher der Baum im Frühling braucht, um neue Blätter sprießen zu lassen.“
Vor allem mit unseren Liebsten sollten wir über unsere Gedanken zur Vergänglichkeit sprechen. Wir können uns unsere eigenen Bilder, Wünsche und Vorstellungen davon machen, wie wir uns das Ende vorstellen. Was uns wohl im Jenseits, im Himmel oder auf der anderen Seite erwarten wird. Ob wir dortbleiben, als Seele herumziehen, oder wieder geboren werden. Jeder wie er mag. Doch die Welt der Hinterbliebenen dreht sich weiter. Und über diese Trauer, dass uns ein Mensch im Alltag fehlen wird, dass wir es vermissen werden, diesem Menschen die Hand zu geben, ihn zu drücken oder ihn einfach nur anzurufen, sollte mal gesprochen werden. Sonst lassen wir sie damit allein. So ein Schmerz scheint anfangs beinahe unerträglich, doch es wird irgendwann langsam weniger, mit der Zeit, langsam immer weniger.
Statt den Tod als Gegenteil des Lebens zu sehen, sollten wir ihn als festen Bestandteil unseres Lebens sehen. Das hilft sich mit der Vergänglichkeit auseinanderzusetzen, bewältigt Hürden und vor allem Angst. Denken wir über unser eigener Abschied nach, macht es uns traurig, weil wir an unsere Lieben, die wir zurücklassen denken. Doch wie so oft und bereits erwähnt: Reden hilft.
Als Kind habe ich von dem offenen Umgang mit dem Thema profitiert. Ein Gespräch mit einem begleitenden Buch kann sehr hilfreich sein. Das Thema nicht als Tabu zu behandeln, ermöglicht gerade angesichts bevorstehender Bestattungen von geliebten Familienangehörigen mehr Verständnis und eine bessere Verarbeitung des Verlusts.
Durch den Gedanken womöglich früher als „normal“ gehen zu müssen, bin in natürlich immer wieder unendlich traurig. Doch die Gespräche mit meiner Familie lassen mich wissen, dass sie das Schicksal annehmen und auch ohne mich zurechtkommen werden. Das hat etwas sehr Beruhigendes für mich.
„Das schönste was ein Mensch hinterlassen kann, ist das Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.“
©Sandra Polli Holstein
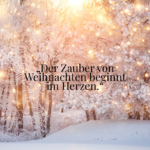



































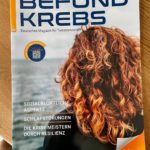

























Das stimmt, der Tod ist eine der natürlichsten Sachen dieser Welt, und trotzdem will keiner gerne darüber reden. Komplett verständlich, man hat Angst davor. Allerdings denke ich schon seit ein paar Jahren, dass es Sinn ergeben würde, wenn man sich schon im Voraus darüber Gedanken machen würde und sich vielleicht sogar bei einem Bestattungsunternehmen über die unterschiedlichen Möglichkeiten zu informieren.
Hallo Anja, ich hoffe das Du ist ok. Wir tun uns oft schwer über Unangenehmes zu sprechen. Die Angst ist ebenfalls die natürlichste Sache der Welt und gehört dazu – schließlich bewahrt sie meist davor, zu große Risiken einzugehen. Es ist mir eine Herzensangelegenheit den Menschen nahe zu bringen, Gedanken über unsere Endlichkeit zuzulassen und den Mut zu fassen, auch mal darüber zu sprechen. Denn ich bin überzeugt davon, dass wir so der Angst die Macht nehmen und bemerken, dass auch dieses Thema Leichtigkeit verdient hat. Vielleicht können wir ja mal gemeinsam eine kleine Post-Reihe in den Sozialen Medien starten. Liebe Grüße